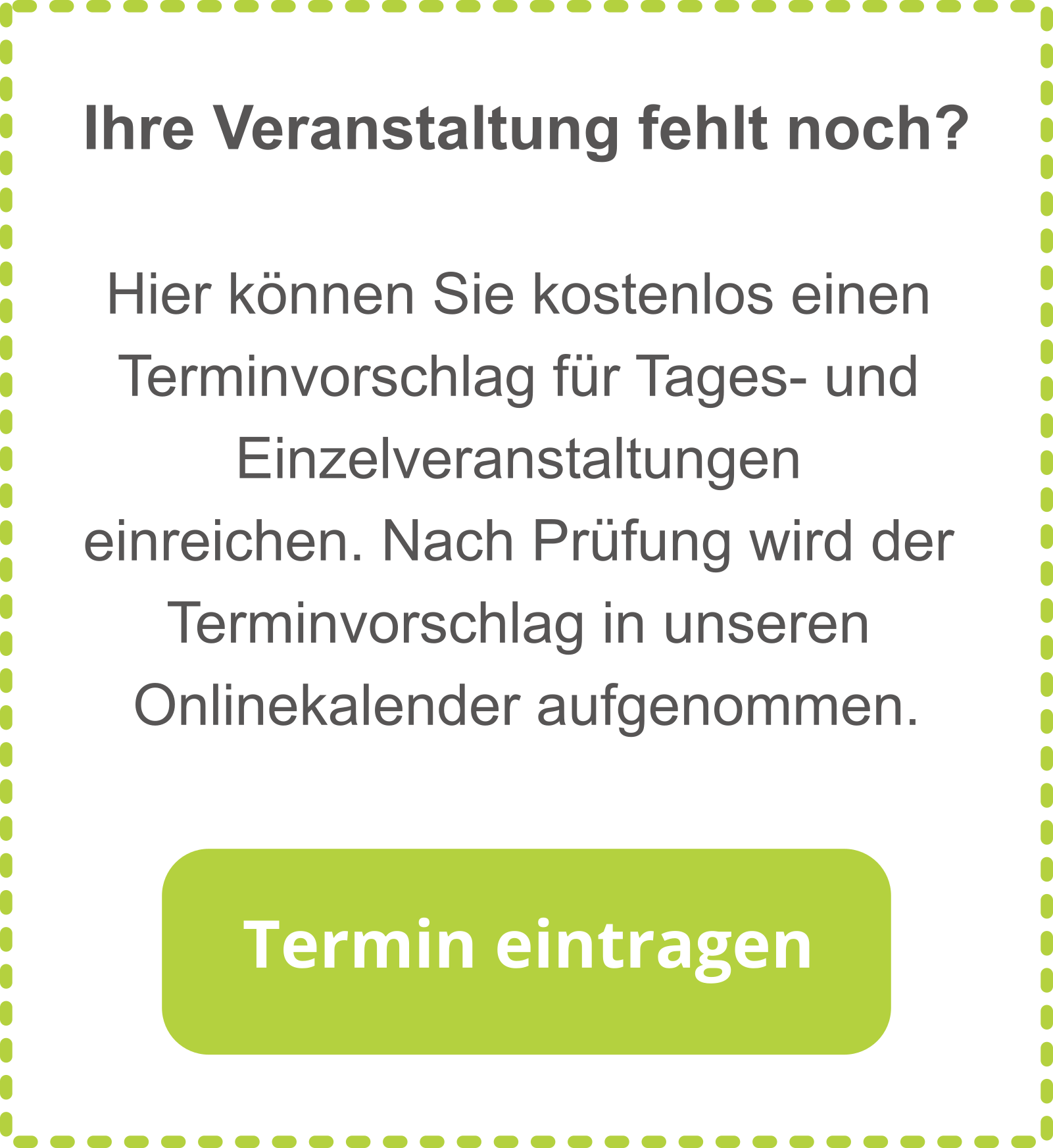Für viele Kinder beginnt mit der Einschulung ein neues Kapitel. Sie lernen lesen, schreiben, rechnen – aber vor allem lernen sie auch, sich in einer neuen Welt zurechtzufinden. Damit das gelingt, braucht es eine Fähigkeit, die oft selbstverständlich vorausgesetzt wird: Sprache.
Kinder müssen nicht perfekt sprechen können, wenn sie in die Schule kommen. Aber sie sollten sich verständlich machen, Anweisungen verstehen und sich in Gespräche einbringen können. Genau das ist nicht bei jedem der Fall. Manche Kinder sprechen wenig, andere haben Schwierigkeiten, Laute richtig zu bilden und wieder andere bleiben im Wortschatz deutlich hinter Gleichaltrigen zurück.
Wann sollten Eltern genauer hinschauen?
Auffälligkeiten im Sprechen werden häufig erst im Vorschulalter deutlich, beispielsweise beim Erzählen, beim Verstehen von Geschichten oder in der Aussprache. Damit Eltern einschätzen können, ob ihr Kind altersgemäß spricht, gibt es sogenannte sprachliche Entwicklungsmeilensteine. Diese bieten eine grobe Orientierung, was Kinder sprachlich in welchem Alter können sollten.
Zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr sollten beispielsweise Laute wie s, ß, z und x beherrscht werden und der Satzbau weitgehend stabil sein. Eine übersichtliche Darstellung solcher Meilensteine findet sich unter anderem beim Deutschen Bundesverband für Logopädie.
Wenn Eltern merken, dass ihr Kind sprachlich deutlich hinterherhinkt oder beim Sprechen auffällige Fehler macht, ist der Kinderarzt der richtige Ansprechpartner. Er kann bei Bedarf eine Überweisung zur Logopädie ausstellen. Dort prüfen erfahrene Fachkräfte, ob ein Förderbedarf vorliegt wie das Kind am besten unterstützt werden kann.
Sprache hat viele Seiten
Sprachliche Auffälligkeiten äußern sich ganz unterschiedlich: Manche Kinder haben Probleme, Wörter zu finden, andere verstehen Anweisungen nur schwer. Auch Schwierigkeiten beim Satzbau, beim Erzählen, bei der Aussprache oder beim Verarbeiten von Gehörtem gehören dazu. In einigen Fällen wirken sich Sprachprobleme auf das spätere Lesen- und Schreibenlernen aus.
Die Ursachen sind ebenso vielfältig. Manchmal sind Hörstörungen, neurologische oder motorische Besonderheiten beteiligt. In anderen Fällen spielt Vererbung eine Rolle.
Auch die heutige Mediennutzung kann Einfluss haben. Wenn Gespräche im Alltag weniger werden, fehlen Kindern oft wichtige sprachliche Anregungen. Sprache entsteht im Miteinander durch Fragen, Antworten, Spielen, Erzählen.
Was Eltern tun können
Kinder brauchen sprachliche Vorbilder. Wer regelmäßig mit seinem Kind spricht, zuhört, Fragen stellt und gemeinsam liest, schafft eine starke Grundlage für die Schulzeit. Schon einfache Rituale wie gemeinsame Mahlzeiten, Vorlesen am Abend oder kleine Erzählrunden über den Tag fördern die Sprachentwicklung auf natürliche Weise.
Und wenn es dennoch holpert? Dann lieber früher aktiv werden als zu spät. Die in Inanspruchnahme einer Sprachtherapie ist keine Schwäche, sondern eine Chance, rechtzeitig die Fähigkeiten zu stärken, die das Kind später täglich braucht.
Denn: Wer sich gut ausdrücken kann, findet leichter Anschluss, versteht den Unterricht besser und startet mit mehr Selbstvertrauen in die Schulzeit.
__________________________________________________________________________________
Weitere Themen rund um Kindergesundheit.